Meine letzte Kolumne zu Biopolitik und Alltag in der Jungle World 45/2022
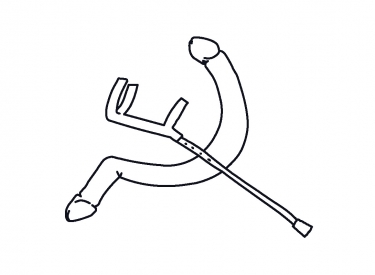 Eine Biopolitik-Kolumne während einer Pandemie und der eigenen Krebserkrankung – über fehlende Themen und Ideen konnte ich mich nicht beklagen, seit ich vor gut zwei Jahren diese Kolumne begonnen habe. Ein Jahr nach meiner letzten Chemotherapie ist es aber nun Zeit, die Kolumne zu beenden. Nicht, weil die Pandemie vorbei wäre oder die Nach- und Nebenwirkungen der Therapie gegen den Krebs nicht kommentierungswürdig wären. Vielmehr entwickelte sich die Textgattung dieser Kolumne eben durch meinen Brustkrebs, die Depression und mein Outing als non-binary von »kritische Kommentare von jemandem mit sehr viel Meinung« zu »angepisste Anmerkungen von einer betroffenen Person mit sehr viel Meinung« – und seien wir ehrlich: Das ist kein Genre, das die Mehrheit meiner ehemaligen Redakteurskolleg:innen aus dem Jungle World-Kollektiv sehr zu schätzen weiß.
Eine Biopolitik-Kolumne während einer Pandemie und der eigenen Krebserkrankung – über fehlende Themen und Ideen konnte ich mich nicht beklagen, seit ich vor gut zwei Jahren diese Kolumne begonnen habe. Ein Jahr nach meiner letzten Chemotherapie ist es aber nun Zeit, die Kolumne zu beenden. Nicht, weil die Pandemie vorbei wäre oder die Nach- und Nebenwirkungen der Therapie gegen den Krebs nicht kommentierungswürdig wären. Vielmehr entwickelte sich die Textgattung dieser Kolumne eben durch meinen Brustkrebs, die Depression und mein Outing als non-binary von »kritische Kommentare von jemandem mit sehr viel Meinung« zu »angepisste Anmerkungen von einer betroffenen Person mit sehr viel Meinung« – und seien wir ehrlich: Das ist kein Genre, das die Mehrheit meiner ehemaligen Redakteurskolleg:innen aus dem Jungle World-Kollektiv sehr zu schätzen weiß.
In einer Zeitung, in der die Kritik an Identitätspolitik manchen wichtiger erscheint als Menschenrechte für Leute mit bestimmten abweichenden Geschlechtsidentitäten (wie beispielsweise nicht missgendert zu werden), kommt mir eine Kolumne als mehrfach selbst betroffene und engagierte Person zunehmend fehl am Platz vor.
»Wir haben uns auseinandergelebt«, wäre wohl die nichtssagend-diplomatische Formulierung, die man auf einer Familienfeier verwenden würde, wenn man nach den Gründen gefragt würde. Das sollte man bitte nicht falsch verstehen: Die Jungle World ist für die Linke eine wichtige Zeitung, in der Missstände analysiert werden, die anderswo keine oder zu wenig Aufmerksamkeit erhalten; ich schätze die ehemaligen Kolleg:innen sehr.
Corona, Krebs, Behinderung, sexuelle, geschlechtliche und reproduktive Rechte sowie die Debatten darüber waren in den vergangenen zwei Jahren die hauptsächlichen Themen dieser Kolumne. Viele biopolitische Themen liegen quer zu den traditionellen Einteilungen von rechten und linken Analysen, das habe ich schon in meinem ersten Buch zu Selbstbestimmung, dem Recht auf Abtreibung und einer intersektionalen Kritik an pränataler Diagnostik festgestellt; die Auseinandersetzungen über die richtige Analyse und Bekämpfung der Covid-19-Pandemie auch unter Linken, die sich kritisch mit dem Gesundheitssystem beschäftigen, hat das mal wieder deutlich gemacht.
Ein anderes Thema sorgt derzeit sogar für noch mehr und meist sehr unschöne Debatten: Die geplante Abschaffung des Transsexuellengesetzes und dessen Ersetzung durch ein bereits in Eckpunkten vorgestelltes Selbstbestimmungsgesetz. Sahra Wagenknecht, Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, hat in der vergangenen Woche ausgerechnet im Interview mit dem konservativen Magazin Cicero die Frage verneint, ob das geplante Selbstbestimmungsgesetz ein linkes Vorhaben sei. »Die ganze Gender-Diskussion« halte sie »für maßlos überzogen«. Sie mache sich Sorgen um das Wohlergehen von »sehr jungen Menschen in der ohnehin schwierigen Phase der Pubertät«, denen »fast schon« nahegelegt werde, »in einem Geschlechterwechsel die Lösung ihrer Probleme zu suchen«. »Viele junge Frauen«, die »zu Recht mit der sozialen Geschlechterrolle, mit den geringeren Verdienst- und Aufstiegschancen, die sie im Vergleich zu Männern heute immer noch haben«, hadern, solle man »nicht motivieren, deshalb ihr biologisches Geschlecht zu verändern«. Zudem sei es gefährlich, dass demnächst »jeder durch einen Eintrag beim Amt mal eben sein Geschlecht ändern kann und Männer dadurch Zugang zum Frauensport, zu Frauenhäusern oder Frauengefängnissen bekommen«. Und sie ergänzt: »Es gibt nun einmal zwei Geschlechter.« Das sind alles talking points, die auch rechte »Demo für Alle«-Aktivist:innen, lesbische Terfs und – leider – auch Kolleg:innen in der Jungle World so vorbringen könnten.
Wenn ein intersektionaler Feminismus als unwissenschaftlich und unmaterialistisch abgetan wird und sogar die überfällige Entscheidung, dass Autor:innen seit diesem Monat mit dem Doppelpunkt entgendern dürfen, statt maximal die binäre Form »Autorinnen und Autoren« benutzen zu können, als »Trend, den viele kritisch sehen« bezeichnet wird, ist es Zeit, sich zu trennen. Diese Kolumne ist leider kein Format, diesen verfehlten Ansichten so entschieden entgegenzutreten, wie es notwendig wäre.
Mit meinem depressiven und von den Nachwirkungen der Chemotherapie beeinträchtigten Gehirn versuche ich zudem seit längerer Zeit, ein Exposé für ein Buch über Brustkrebs, Gendermedizin und kapitalistische Gesundheitspolitik zu schreiben, aber seit der Erkrankung bin ich nur recht eingeschränkt konzentrations- und arbeitsfähig. Und auch viel weniger belastbar. Dabei war es in der Vergangenheit oft entlastend, mit der Kolumne ein Ventil zu haben, durch das ich den bei der Krebsbehandlung entstandenen Druck ablassen konnte: absurde Gespräche im Chemoraum, unlogische Covid-19-Schutzregeln, die zu mehr Gefährdung führten, unerwartete Nach- und Nebenwirkungen der Krebsbehandlung. Aber Bücher und Exposés sind ein bisschen wie Diamanten – wenn man zu wenig Druck hat, entsteht nichts. Die Entscheidung, diese Kolumne aufzugeben, ist also auch der Hoffnung geschuldet, dass mit der freiwerdenden Energie und dem sich anstauenden Druck ein Exposé für das Buch zustande kommt. (An Verlage, die Interesse haben: Meine DMs sind offen!)
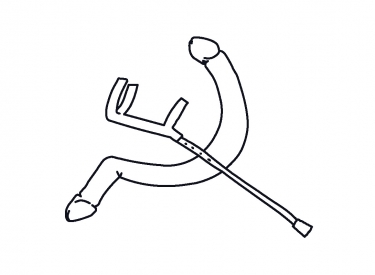 Eine Biopolitik-Kolumne während einer Pandemie und der eigenen Krebserkrankung – über fehlende Themen und Ideen konnte ich mich nicht beklagen, seit ich vor gut zwei Jahren diese Kolumne begonnen habe. Ein Jahr nach meiner letzten Chemotherapie ist es aber nun Zeit, die Kolumne zu beenden. Nicht, weil die Pandemie vorbei wäre oder die Nach- und Nebenwirkungen der Therapie gegen den Krebs nicht kommentierungswürdig wären. Vielmehr entwickelte sich die Textgattung dieser Kolumne eben durch meinen Brustkrebs, die Depression und mein Outing als non-binary von »kritische Kommentare von jemandem mit sehr viel Meinung« zu »angepisste Anmerkungen von einer betroffenen Person mit sehr viel Meinung« – und seien wir ehrlich: Das ist kein Genre, das die Mehrheit meiner ehemaligen Redakteurskolleg:innen aus dem Jungle World-Kollektiv sehr zu schätzen weiß.
Eine Biopolitik-Kolumne während einer Pandemie und der eigenen Krebserkrankung – über fehlende Themen und Ideen konnte ich mich nicht beklagen, seit ich vor gut zwei Jahren diese Kolumne begonnen habe. Ein Jahr nach meiner letzten Chemotherapie ist es aber nun Zeit, die Kolumne zu beenden. Nicht, weil die Pandemie vorbei wäre oder die Nach- und Nebenwirkungen der Therapie gegen den Krebs nicht kommentierungswürdig wären. Vielmehr entwickelte sich die Textgattung dieser Kolumne eben durch meinen Brustkrebs, die Depression und mein Outing als non-binary von »kritische Kommentare von jemandem mit sehr viel Meinung« zu »angepisste Anmerkungen von einer betroffenen Person mit sehr viel Meinung« – und seien wir ehrlich: Das ist kein Genre, das die Mehrheit meiner ehemaligen Redakteurskolleg:innen aus dem Jungle World-Kollektiv sehr zu schätzen weiß.